Inhalt
Das Wichtigste in Kürze
Streulinsen (oft auch Zerstreuungslinsen oder bikonkave Linsen genannt) sind in der Mitte dünner als aussen (konkav). Durch die Brechung werden die Lichtstrahlen in der Streulinse so umgelenkt, dass parallele Strahlen nach der Linse auseinander driften oder eben gestreut. Streulinsen erzeugen immer aufrechte, verkleinerte, virtuelle Bilder.
Streulinsen finden wir z.B. als Korrekturgläser für Kurzsichtige. Sie finden sich aber auch in Objektiven und anderen optischen Instrumenten.
Die Linsengleichung, mit welcher die Bildweite \(b\) aus der Gegenstandsweite \(g\) und der Brennweite \(f\) der Linse berechnet werden kann gilt auch für Streulinsen, allerdings muss die Brennweite negativ eingesetzt werden, da der Brennpunkt auf der “falschen” Seite der Linse ist:
\[ \frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} \quad \mathrm{mit} \quad f<0 \]
Tutorial Videos
(Es gibt leider keine Tutorial Videos zu diesem Thema)
Streulinsen (oft auch Zerstreuungslinsen oder bikonkave Linsen genannt) sind in der Mitte dünner als aussen (konkav). Durch die Brechung werden die Lichtstrahlen in der Streulinse so umgelenkt, dass parallele Strahlen nach der Linse auseinander driften oder eben gestreut.
Streulinsen finden wir z.B. als Korrekturgläser für Kurzsichtige 👓. Sie finden sich aber auch in Objektiven und anderen optischen Instrumenten.
Ähnlich wie Konvexspiegel, erzeugen Streulinsen ein verkleinertes Bild, das aber mehr Übersicht vermittelt. Typischerweise sehen wir die Umgebung unter einem grösseren Winkel und gerade Linien werden so verzogen, dass sie gekrümmt sind.

Brennpunkt und Brennweite einer Streulinse
Die Funktionsweise der Streulinse können wir mit Hilfe von Prismen verstehen. Die beiden parallelen Strahlen werden nach aussen ausgelenkt und verlaufen danach auch nicht mehr parallel, sondern leicht auseinander. Deren gemeinsamer, aber nur scheinbarer Ursprungsort ist der Brennpunkt \(F\). Es handelt sich um einen virtuellen Brennpunkt. Die Strahlen sind nie wirklich im Brennpunkt. Es ist deshalb unmöglich, dass Sonnenlicht auf eine Streulinse jemals einen Brand verursachen könnte.
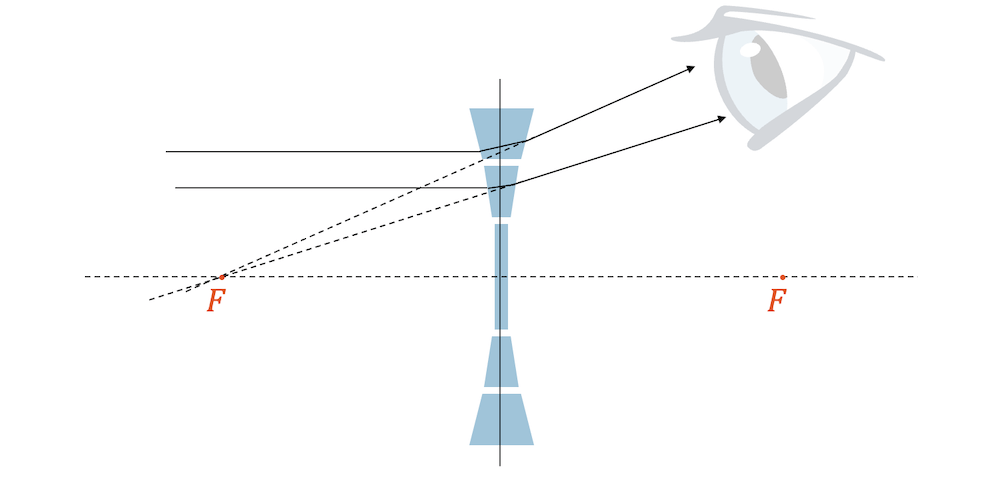
Dank dem Brechungsgesetz verstehen wir, dass die parallelen Strahlen nach der Linse auseinander laufen. Nur der Lichtstrahl auf der optischen Achse trifft genau senkrecht auf das Medium der Linse und behält deshalb seine Richtung.
Die Parallelstrahlen verlaufen nach der Streulinse in der Art, als kämen sie alle aus dem Brennpunkt \(F\). Es gilt deshalb auch hier die Regel:
Parallelstrahlen werden durch die Streulinse umgelenkt zu Brennpunktstrahlen
Brennpunktstrahlen werden durch die Streulinse umgelenkt zu Parallelstrahlen
Auch die Streulinsen haben immer zwei Brennpunkte, die auf der optischen Achse und im gleichen Abstand von der Linsenebene liegen (Brennweite \(f\)). Stark gekrümmte Linsen brechen die Strahlen stark und haben eine kurze Brennweite.
“Der Beobachter sieht Strahlen, die scheinbar aus dem Schnittpunkt der Verlängerungen kommen. Das ist der virtuelle Bildpunkt.”
Entstehung eines virtuellen Bildes
Wir betrachten wieder eine Kerze als unseren Gegenstand. Die Flammenspitze sendet Lichtstrahlen in alle Richtungen. Wir brauchen aber nur zwei spezielle Strahlen, um einen Bildpunkt zu kriegen.
Wir können sicher den Parallelstrahl nehmen und ihn zu einem Brennpunktstrahl machen.
Der Brennpunktstrahl würde auch gehen, allerdings muss hier beachtet werden, den richtigen Brennpunkt zu verbinden. Die Streulinse hat einen virtuellen Brennpunkt. Wir dürfen deshalb nicht den linken Brennpunkt wählen, sondern müssen den unerreichbaren Brennpunkt auf der anderen Seite der Linse nehmen. Nur die Verlängerung erreicht ihn; der physikalische Strahl wird an der Linse gebrochen.
Grundsätzlich gibt es auch bei der Streulinse den Scheitelpunktstrahl, den du vermutlich vom Konkavspiegel kennst. Er wird oft auch Mittelpunktstrahl genannt, doch diese Bezeichnung wäre problematisch, wenn wir sie beim Konkavspiegel anwenden wollten, weil es dort einen anderen Strahl gibt, der so heisst.
Beim Konkavspiegel haben wir für den Scheitelpunktstrahl mit dem Reflexionsgesetz argumentiert und gesagt, dass er mit gleichem Winkel reflektiert wird (Reflexionswinkel), wie er auf den Spiegel eingefallen ist (Einfallswinkel).
Bei der Linse haben wir keine Reflexion, aber der Scheitelpunktstrahl ist sehr praktisch, weil einfach zu zeichnen. Er wird ungebrochen durch die Linsenebene gezeichnet. Er verhält sich analog zum Spiegel, d.h. er verlässt die Linsenebene in gleichem Winkel, wie er auf sie aufgetroffen ist.
In Realität verläuft der Strahl parallel zum ursprünglichen Strahl, aber leicht versetzt. Die Dicke der Linse bestimmt, wie stark versetzt der Strahl nach der Linse ist. Da wir aber von sehr dünnen Linsen ausgehen, vernachlässigen wir diesen Effekt.

Beachte auch: Es ist in der Optik üblich, die Brechung nur mit einer einzige Brechung in der Linsenebene darzustellen. Oft wird der Linsenkörper gar nicht gezeichnet. Wir haben den Linsenkörper hier im Hintergrund angedeutet, damit wir nicht vergessen, um welche Art von Linse es sich handelt. 🧐
Der Beobachter sieht jetzt drei Strahlen und alle kommen scheinbar aus einem virtuellen Bildpunkt. Wir können deshalb das virtuelle Bild der Kerze aufzeichnen. Es ist, wie erwartet, verkleinert und aufrecht.
Bei der Streulinse gibt es immer virtuelle, aufrechte Bilder, die kleiner sind als der Gegenstand selber.
Im Vergleich zur Sammellinse gibt es keinen “Kipppunkt”, wo ein aufrechtes Bild zu einem umgekehrten Bild wechselt oder umgekehrt. Wir können den Gegenstand auch ganz nahe an die Linse heranbringen. Im Gegensatz zur Sammellinse sind wir mit dem Gegenstand nicht über den entscheidenden Brennpunkt gegangen, sondern nur etwas näher an den virtuellen Brennpunkt auf der anderen Seite der Linse.
Linsengleichung
Für Streulinsen gilt die Linsengleichung auch. Sie erlaubt z.B. die Berechnung der Bildweite \(b\) aus der Gegenstandsweite \(g\) und der Brennweite \(f\) der Linse. Die Brennweite wird aber mit einem negativen Betrag eingesetzt, da der Brennpunkt virtuell ist, d.h. auf der “falschen” Seite der Linse ist:
\[ \frac{1}{f} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} \quad \mathrm{mit} \quad f<0 \]
Da das Bild virtuell ist, wird auch die berechnete Bildweite \(b\) negativ sein. Gemeint ist damit, dass auch das Bild sich auf der “falschen Seite” der Linse befindet.
Beispiel
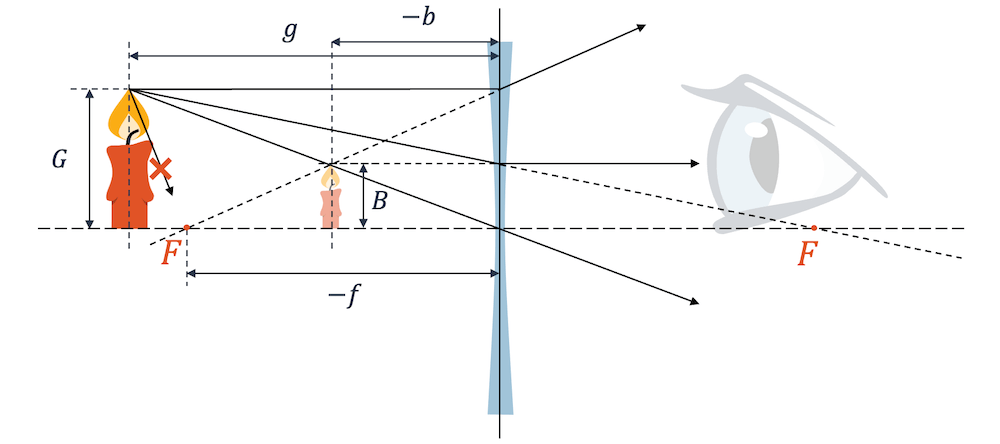
Simulation
Mit der folgenden Simulation kannst du die Entstehung von reellen und virtuellen Bildern und die ganze Strahlenkonstruktion sehr einfach nachvollziehen. Es lohnt sich ein bisschen damit herum zu spielen, um ein Gefühl für die richtigen Strahlenläufe zu entwickeln.
Bewege die Spitze des Gegenstands Object mit der Maus. Der Brennpunkt wird verändert, indem du das Label Focus‘ verschiebst.
Simulation der Strahlenverläufe durch eine Sammel- bzw. Streulinse
Weitere Videos
(keine externe Youtube-Videos zu diesem Thema)
Aufgabensammlung
Lernziele
Mini-Test
Um Zugang zum Mini-Test zu kriegen,
musst du vollwertiges Mitglied im Hacker-Club sein.
publiziert:
überarbeitet:
publiziert:
überarbeitet:
Schreib deine Frage / Kommentar hier unten rein. Ich werde sie beantworten.
Inhalt

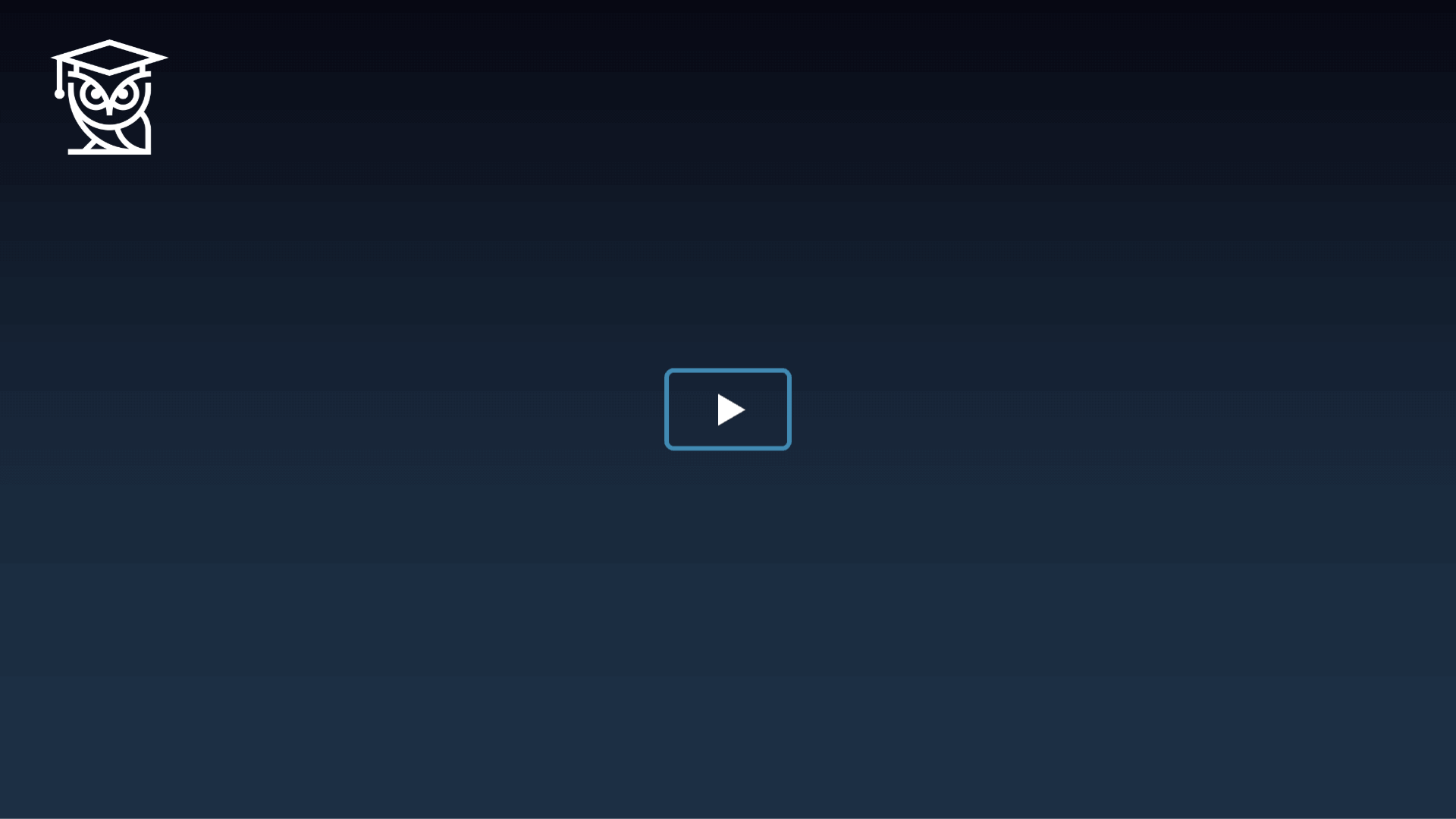


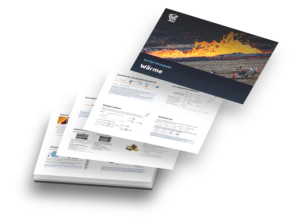

Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.